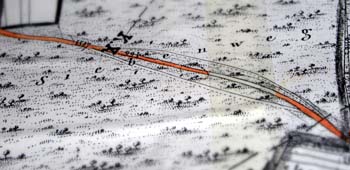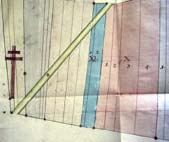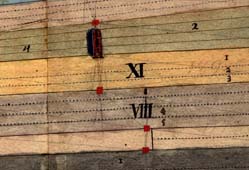Brücken
in die Vergangenheit
Kürnach (MAD)
Im Jahr 2004 feierte Kürnach
sein 1225 Jähriges bestehen mit einem großen Fest, zu dem eine
sehr umfangreiche Chronik der Geschichte erschien. In diesem Jahr hatte Reinhard
Heinrich, Forstwirt der Gemeinde Kürnach, die Idee an die Namen der Waldstücke
zu erinnern die bei vielen in Vergessenheit gerieten und bei Neubürgern
völlig unbekannt sind. Er schnitzte die ersten Namen in Bretter und hängte
diese an Bäume entlang der Wege in den Zugehörigen Gemarkungen.
Es sind Namen wie „Siebenweg“, „Holzwiesen“ oder „Kohlplattenweg“.
Dieses Jahr sind weitere Schilder dazu gekommen. Mittlerweile sind es über
20 Schilder die Fahrradfahrern und Spaziergängern anzeigen wo sie sich
befinden. „Wenn man jemanden erklären wollte wie man über
den Berg nach Estenfeld kommt, musste man immer sagen: Den Weg hoch unter
der Autobahn hindurch. Jetzt kann man wieder sagen: ganz einfach über
den „Hafler“ am „Brühl“ vorbei.“, so Reinhard
Heinrich. Er ist stolz darauf. Das merkt man ihm an. Reinhard Heinrich, lebt
und arbeitet in Kürnach und er liebt das Dorf. „Bis jetzt sagte
man die ‚Erdeponie’, nun gibt es wieder den ‚Speierleinsrain’,
das klingt doch zudem viel besser so Reinhard Heinrich. Ein Jogger der seine
große Runde um den Hartwald zieht nennt noch einen weiteren Punkt: „Jetzt
hat man auch wieder mehr Ziele. Man kann sich viel besser ausdrücken,
wenn man sagt, wo man entlang gelaufen ist.“ 1. Bürgermeister Manfred
Ländner ist sehr erfreut über diese Aussage. „Das ist genau
das was wir damit erreichen wollten. Den Bürgerinnen und Bürgern
von Kürnach wieder einen Bezug zu ihrer Landschaft zu geben. „Wir
wollen, dass die Freizeitsportler und Wanderer eine Bindung zu den Wiesen,
Feldern, Wege und Wäldern und mit deren über 100 Flurnamen bekommen.
Alle Schilder sind so aufgestellt, dass sie die Landwirte so wenig wie möglich
behindern.“, so Manfred Ländner.
„Wer kennt denn schon den Gämerleinsgrund? Nur die wenigsten. Oder
deren Bedeutung? Wahrscheinlich nur eine Handvoll Kürnachern. Das ist
wohl einer der ältesten und bedeutsamsten Flurnamen in Kürnach.
Das kommt aus dem Keltischen ‚Goumen’, ‚Bewachen’.
Hier waren wohl die ersten Waldrodungen und Hügelgräber.“,
klärt Reinhard Heinrich auf. Gekostet hat die Sache nichts. Die Stangen
sind von alten Verkehrschildern, die Bretter, „das bischen Holz“
hat Reinhard Heinrich immer auf Lager und geschnitzt hat er das in seiner
Freizeit. Reinhard Heinrich ist auch Obmann der Siebener, die Feldgeschworenen.
Dadurch kennt er sich natürlich bestens mit den Flurnamen aus, die schon
sein Vater gehütet hat. Diese Namen sind wie „Brücken in die
Vergangenheit“, wie es in der Kürnacher Chronik steht. Sie erzählen
uns von Geschichten unserer Vorfahren.

Reinhard
Heinrich, Forstwirt und Siebener Obmann, mit Manfred Ländner, 1. Bürgermeister
der Gemeinde Kürnach
Im „Gämerleinsgrund“ an einem der etwa 20 neuen Flurnamenschilder.
- - -
Aus
der Kürnacher Ortschronik von Christine Demel
Flurnamen – Brücken in die
Vergangenheit
Versuch einer Deutung
Unter dem Titel „Unser keltisches Erbe“ veröffentlichte
1994 die Sprachwissenschaftlerin Dr. Inge Resch-Rauter ein Buch, das sich
unter anderem mit den Flurnamen als Brücken in die Vergangenheit befasst.
Flure wurden von den ersten Bauern benannt, die die Wälder urbar gemacht
haben.
Diese Namen gaben sie weiter an Kinder und Kindeskinder.
Kamen fremde Völker, also in unserem Bereich germanische Siedler in das
von Kelten bewohnte Land, wurden diese Flurnamen übernommen, waren aber
oft nicht mehr verständlich und wurden nur mehr dem Klang nach weitergesagt.
Dabei wurden sie abgeschliffen, Endungen verkürzt, Vokale gefärbt.
Manche Flurnamen sind über Jahrhunderte phonetisch gleichgeblieben, ihr
Sinn aber war verlorengegangen. 1
Resch-Rauter hat dazu eine Sammlung von keltischen
Ausdrücken mit ihren Bedeutungen zusammengestellt, in
der auch für Kürnach, das nachweislich auch von Kelten der späten
Hallstattzeit und Latènezeit besiedelt war, einige Bedeutungen von
Flurnamen verständlich werden.
Besonders interessant dabei ist das Flurstück:
„Am Kellermann, der Machel genannt“ , wie man es noch 1773 in
einem Grund-Zins-Register des Dietricher–Spitals Würzburg nannte.
2

Am Kellermann oder Kellermänner heißt die Flur noch heute –
nur „Machel“ ist nicht mehr gebräuchlich.
Es ist die Flur von der Grießmühle bis zum Brühl und zur alten
Autobahnauffahrt.
C wird wie K gesprochen.
Celtoi (kelt.) = Kelten.
Cell–i (kelt) = Heiligtum, Wald, Gehölz, Grab.
Das Wort „Kellermann“, „Kellermänner“ kann von
Germanen gebildet worden sein: Das Flurstück, wo die „Kelten-Männer“
wohnten. Kelten der späten Hallstattzeit haben dort wirklich gewohnt,
wie die Funde aus der Vorgeschichte beweisen und auch die neuen Sondierungsgrabungen
2004 auf der Trasse der Direktanbindung an die B 19 schon ergeben haben.
Das Wort „Machel“ oder Mahel“ (ahd.) kommt aus dem indogermanischen
„Mal“ = Mal- oder Gerichtsstätte.
Kelten hielten Gericht bei ihren Heiligtümern, auch bei ihren Toten auf
den Hügelgräbern. So ist es möglich, dass beim Eindringen germanischer
Stämme ein uralter Gerichtsplatz übernommen wurde.
Denn noch im frühen Mittelalter tagte das fränkische
Zentgericht für die 10 Orte, Estenfeld, Lengfeld, Kürnach, Versbach,
Rimpar, Unterpleichfeld, Grumbach, Rupprechtshausen, Mühlhausen und Ober–Rothof
am Hang des
Wachtelberges „uff den Rhödern“. Die Flur „Galgengrund“
liegt dabei, ebenso die Flur „Gänßleiten“, was sicher
nichts mit Gänsen zu tun hat, denn diese Flurlage liegt weit draußen
zwischen den Orten Kürnach und Estenfeld. Eher erzählt dieser Name,
dass sich dort die Sippe oder der Stamm, lat. „gens, gentis“ versammelt
hat.
Der oberhalb des „Kellermann“ liegende Brühl (Brüel
= feuchter Buschwald) hatte aber auch das Beiwort „frei“: „freier
Brüel“. 3
Alte Gerichtsstätten, oft auch neben der Kirche auf Friedhöfen gelegen,
waren auch „Freistätten“ oder Asylplätze.
Oberhalb des Brühls, auch oberhalb der Grießmühle und östlich
der Autobahntrasse wurde 1757 ein Flurstück am Haflersweg „auf
Hafflers Höhe an der rosen Leyden“ 4 bezeichnet, was auf eine alte
Begräbnisstätte hinweist und nicht auf die Blume Rose.
Rosen kamen erst um das Jahr 800 aus dem Orient über Griechenland nach
Europa. Sie können mit dem Flurnamen „an der rosen Leyden“
nichts zu tun haben, dafür aber mit Gräbern: Luftaufnahmen des Landesamtes
für Denkmalpflege haben in der Nähe drei Gruppen verschleifter (überackerter)
Hügelgräber sichtbar gemacht.
Vielfach wurden vor- und frühgeschichtliche Begräbnisstätten
als Rosengarten bezeichnet. Nach Ranke 5 leitet sich der Name von dem die
rote Kultfarbe tragenden Sakralbereich ab.
In der Nähe liegt auch die Flur Hüthstatt (auch Hüttstatt),
aus der es immer wieder Lesefunde aus der Jungsteinzeit und Hallstattzeit
gibt.
Der Name „Hafler“ – „auf Haflers Höhe“
– „Haflersweg“ wird 1773 deutlicher: „am Haffler oder
Hohefluhr“. 6
Stellt man sich nun die Siedlung der Kelten von der Grießmühle
bis an die alte Autobahnauffahrt vor und ihre Hügelgräber oberhalb
des Brühls und der Grießmühle auf dem „Hoheflur“
oder Haffler, kann man auch daran denken, dass schon damals der Bach einen
Namen hatte. Kelten haben dem Main, der Saale, der Tauber und der Pleichach
den Namen gegeben – warum nicht auch der Kürnach?
Bislang galt „quirnaha“ als althochdeutscher Name aus „quirn“
= „Mühle“ und „aha“= „fließendes
Gewässer“ gebildet.
Da aber die Kelten zwar schon rotierende Mühlsteine mit Handbetrieb kannten,
Wassermühlen dagegen erst im Mittelalter an den Bächen standen,
sollte man an das keltische Wort für „Bergsporn (mit Befestigung)“
= „Cornu“ denken, das sich zu Kurn-Korn-Kirn entwickeln konnte.
7
Der Bach Kürnach wäre dann der Bach, der an einem Bergsporn vorbeifloss,
auf dem heute die Kürnachtalbrücke aufliegt.
„Quirnaha“ tritt in zwei Urkunden von 779 und 822 auf, danach
aber Jahrhunderte als „Curnhaa“, „Curna“, „Kurnach“,
„Kornach“ und „Körnach“. Erst im 19. Jh.
wird Kürnach daraus, in der Mundart bleibt es bei „Körni“.
Die Untersuchungen von Volker Friedrich zur Entstehung des Namens Kürnach
(Manuskript, unveröffentlicht), das sich mit Mahlsteinen und Mühlen
befasst, haben mir Mut gegeben, dieses kleine Kapitel zu schreiben.
Kelten hätten damit auch der Kürnach und dem Dorf den Namen gegeben.
Kelten haben aber auch im heutigen Dorfbereich bis in die Nähe der Kürnachquellen
und südlich der Ortsumgehung gesiedelt, wie die Funde der Reste von Glasarmreifen
und andere Scherben der späten Hallstatt- und Latènezeit aussagen.
Auch die Hügelgräbernekropole im Hartwald ist vermutlich in die
Hallstattperiode zu datieren.
1 Resch-Rauter, a.a.O. S. 474
2 StAW, Rent-Amt Würzbg. r.d.M. Nr. 30 Register des Dietricher Spitals
über Kürnacher und Estenfelder Grund-Zins.
3 Grimm, Deutsches Wörterbuch
4 StAW, Rent-Amt Würzbg. r.d.M. Nr. 29, Güldt-Zins– und Lehenbuch
eines hochwürdigen Dom–Capitels zu Würzburg, Lehenbuch über
Kürnach.
5 Ranke, K., in: Rosengarten, Recht und Totenkult, Hamburg 1951, in: Resch-Rauter,
S. 353
6 Siehe Anmerkung 2
7 Resch-Rauter, a.a.O. S. 474von wem errichtet, von welchem Bildhauer, welcher
Bes
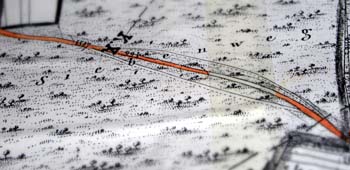
Die
Flurnamen der Gemarkung von Kürnach
Reinhard Heinrich
Ermelinde Heinrich
Konrad Heinrich, gest. am 29.3.1979, ehemaliger Obmann der Feldgeschworenen
Kürnachs und 2.
Bürgermeister
Nach
den vollständigen Kürnacher Flurbüchern
von 1783, 1784 und 1786 der Flure gegen Rimpar, gegen Dettelbach und gegen
Prosselheim. 1
I.Band: Das Rümparer Fluhr Buch von 1783
Geprägter Ledereinband, 38x24 cm, viele farbige Tafeln.
Die Karten mit den verzeichneten Nummern findet man in der Kürnacher
Dorfchronik von 2004, 936 Seiten auf den Seiten 509 und 511.

1 Am Frohngraben: Von der äußeren Bushaltestelle ortswärts
Richtung „Neuer Berg“ und bis zum „Mühlhauser Weg“.
2 Bei der Heiligen Wiese: Quellgebiet des Bächleins bis zur Unterpleichfelder
Straße.
3 An der Laime Grüben: Ehemalige Lehmgruben südlich der Unterpleichfelder
Straße etwa bei Anwesen Stark und etwas dorfwärts.
4 Im Gämerleinsgrund: Westlich der „Heiligen Wiese“ vom Ortsrand
bis zum Mühlhäuser Weg, stößt im Westen an den Frohngraben
5 Am Neuen Berg: Hang westlich des Dorfes.
6 Leidlein (Leiden) am Neuen Berg: Bei Anwesen Demel/Ebert.
7 Mühlhäuser Feld: Liegt nordwestlich der Kreuzung Unterpleichfelder
Straße – B 19.
8 Am Langen Weinberg: Gebiet zwischen ehemaliger Autobahnauffahrt und Autobahnbrücke.
9 Ober der Steegsweinberg
10 An der Röthen: Östlich der Autobahnbrücke (Hang) des Wachtelberges.

Traktor auf dem Weg zur "Rümparer Höhe".
11 Auf der Rümparer Höhe: Höchste Erhebung im hinteren Mühlhäuser
Feld.
12 Am Wachtelberg: Westlich der Rimparer Höhe.
13 Am, Obern, im Galgengrund: Bei der Autobahnauffahrt.
14 Am Eißen Fresser: An den Steinbrüchen im Wachtelberg.
15 Unter, An der Lange Läng: Hang vom Galgengrund zu den Steinbrüchen.
16 Am Weidenbag (Baag): Südlich der unteren Einfahrt nach Kürnach.
17 Untern Kellermann: Obern Kellermann: von der B 19 Richtung Steinbrüche
(Schlecker) zwischen ehemaliger Autobahnauffahrt und Autobahnbrücke.
18 Die Bärenleiten: Hang direkt an der Autobahnbrücke zwischen Kellermann
und Röthen.
19 Bey den Hünnerbrunnen: Unterhalb vom Hafler an der Estenfelder Grenze.
20 Bey, An, Unter der unteren Mühle: An der Grießmühle, früher
Reiche Weingartsmühle.
21 Im Brüel: Weiterführung des Hanges „Bärenleiten“
Richtung Westen.
22 An der Hüzstatt (Hüthstadt): Oberhalb der Grießmühle
(südöstlich).
23 Am Anspach: Östlich der Grießmühle Richtung Dorf.
24 An der Krume Krautäcker: Westlich der Siedlung Krautäcker von
der
Flurstraße Richtung Bach.
25 Am, Untern, Obern Haflersweg: Südöstlich der „Hüzstatt“
und westlich der „Krumme Krautäcker“ über Haflerhöhe
bis zur Gemarkungsgrenze nach Estenfeld.
26 Am, Das Hohe Seelein: Westlich der „Krumme Krautäcker“
an der „Schlittenbahn“.
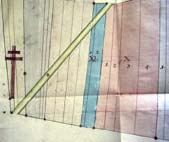
Das Patriarchenkreuz.
27 Unterm, Am Rothendorfer Weg: Am Kreuz am Fuchs. Dort stand 1723 noch ein
sog. Patriarchenkreuz.
28 Ober der Hafler Höhe: Höhe südlich vom Flurweg zu Autobahn.
29 Am Fuchs: Westlich vom Kreuz am Fuchs bis zur Estenfelder Gemarkungsgrenze,
Trennung zum Hafler, der Große Stein (ehemaliger kleiner Steinbruch).
„Am grossen Stee“.
30 An die 40 Äcker: Südöstlich vom Kreuz am Fuchs bis zum Estenfelder
Wald bis in östlicher Richtung „auf dem Hellberg“.

Die Evangeliumseiche von Kürnach. Prosselsheimer Fluhrbuch
von 1784.
31 Bei der Evangeliumseichen: Südlicher Teil der „40 Äcker“
am Estenfelder Holz (Am Waldeck Estenfelder Holz an den „40 Äckern“
- Erleinbach).
II.Band: Das Prosselsheimer Fluhrbuch von 1784
Geprägter Ledereinband, 38x24 cm
Bezeichnung der Flurstücke
32 Hinter dem Pfarrgarten: Hinter dem Jugendheim Richtung Osten bis
Anwesen Titus Heinrich.
33 Am Pförtlein: Südlich von „Hinter dem Pfarrgarten“,
„Hahnenhof“ bis Anwesen August Dülk.
34 Bei dem Pförtlein: Zwischen dem Anwesen Dülk – Riederer
(weiter in Richtung Osten von „Am Pförtlein“).
35 Hinter dem Pförtlein: Südlich von „Bei dem Pförtlein“,
Gebiet von Macksgasse, rechts von der Fr.-Ebert-Straße bis zum Bach.
36 Am Mühlweg (stößt Mühlweg): auf den Von der Prosselsheimer
Straße zur Fr.-Ebert-Straße östlich der heutigen Mühlwegstraße.
37 Bei der oberen Mühle: Östlich von „Am Mühlweg“
bis zum jetzigen östlichen Ortsrand.
38 Stoßt auf den Riedweg: Heute mundartlich „Steerutsche“
genannt, Hang nördlich der Gärten an der Oberen Mühle.
39 Bei dem Pflugsgärtlein: Nur 1 Acker östlich der Steerutsche (anschließend).
40 Unterm Prosselsheimer Weg: Vom Pflugsgärtlein in Richtung Osten bis
an die Prosselsheimer Straße.
41 Riedweg: Weg an der oberen Mühle in Richtung Schwarzer Brunnen (wahrscheinlich
links vom Bach).
42 Bey dem rothen Märterlein: An der heutigen Roten Marter, östlich
der oberen
Mühle.
43 Am oberen Thor: Von der Friedhofsstraße bis Anwesen Krammel und von
der Prosselsheimer Straße bis zum alten Pleichfelder Weg (ungefähr
Verlauf der Flurstraße am Oberen Tor).
44 Nonnenpfad: Anwesen Gregor Heinrich bis Markus Ramold.
45 Ober dem Prosselsheimer Weg: Richtung Osten, links der
Prosselsheimer Straße.
46 Am Schleffweg: Nördlich von „Ober dem Prosselsheimer Weg“
bis zur Gemarkungsgrenze.
47 Auf dem (bei dem) Unterpleichfelder Hohlweg: Am alten Unterpleichfelder
Weg (ehemaliger Hohlweg – von der Kreuzung östlich vom Friedhof
Richtung Nordosten.
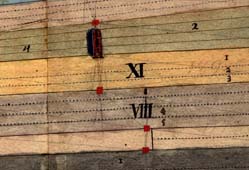
48 Neben (ober, bei) dem Hohen Gütterstein: Am Weg oberhalb der heutigen
Tennisplätze (etwas östlich, auf der Karte im Prosselsheimer Flurbuch
von 1784 Seite 164 eingetragen).

Am Steinmäuerlein. ©Foto: mdemel
49 Am Steinmäuerlein: Nördlich vom Friedhof, Verbandsschule und
Tennisplätzen bis an die Unterpleichfelder Gemarkungsgrenze.
Hier verlief die „alte Straß“ in Richtung Oberpleichfeld
50 Hinter den Alten Höfen, Bei der Marter: Ehemalige „Krämersmarter“,
Gabelung Friedhofstraße, Gehweg zur Schule.
51 Ober, neben der Heiligen Wiesen: An der Heiligen Wiesen-Quelle Richtung
Burggrumbach und Mühlhausen bis zum Ortsrand.
52 Am Mühlhäuser Weg: Am jetzigen Mühlhäuser Feldweg an
der B 19.

Am Grumbacher Pfadt. ©Foto: mdemel
53 Am Grumbacher Pfadt: Ehemaliger Weg, abzweigend vom Mühlhäuser
Weg nach Burggrumbach. Windet sich in einer Geländemulde zur B 19.
54 Am Mühlhäuser Feld über der Straß: In westlicher Richtung
der
B 19 alt (und südwestlich der Einmündung der Mühlhäuser.
Straße) Industriepark.
55 In Mühlhäuser Feld An der ehemaligen Marter,
bey der Marter: nördlich der Umgehungsstraße und westlich der B
19 alt.
56 Im Mühlhäuser Feld stoßt auf die alte Straß: Zwei
Äcker neben „Im
Mühlhäuser Feld bey der Marter“.
57 Am, Im Hohen Hellberg: Heutiger Höllberg.
58 An der Evangeliums- Links der Straße durch den eichen: langen Höllberg
Richtung Haardt am 1. Waldeck.
59 Am Stutz: Über dem Hang Schuttplatz Richtung Osten.
60 An der Haart:
Auf der Haart: Südlich von „Im Hohen Hellberg“ zwischen Estenfelder
Holz und Kürnacher Wald.
61 Im Erleinbach: Äcker neben dem Erleinbach, der sich durch die „Haart“
Richtung Süden zieht (kleines Rinnsal, mündet in Estenfeld in die
Kürnach).
62 Hinter der Haart: Südlicher Teil der „Haart“ bis zur Rothofer
(Rottendorfer) Gemarkungsgrenze.
63 Am Eichelrehen:
An der Hart: Steiler Hang in der hinteren Haart (Wiesental).
64 Hinter der Hart:
65 Bey dem Kreutz: Südlichster Punkt (Knick in der Gemarkungsgrenze).
66 Im Aubweg: Gebiet in Verlängerung der Straße durch den Wald
bis zu den Seligenstädter Äckern.
67 Im Gereut: Nördlich von „Im Aubweg“, von den Aussiedlerhöfen
bis zu den Seligenstädter Äckern.
III.Band: Das Dettelbacher Fluhrbuch von 1786
Geprägter Ledereinband, ca. 38 x 24 cm69 Am Krautsbrunnen: Siedlung vom
alten Feuerwehrhaus in Richtung Grießmühle.
70 Am Sauacker:
Ober der Lange Wiesen: An den Hallen am alten Feuerwehrhaus Richtung Stutz.
71 (Trieb) Wahrscheinlich Gemeinde-baumland mit Wiesen zwischen Hohem und
Langem Höllberg.
72 Küheleiten: Acker rechts vom Hohlweg zum Langen Höllberg.
73 In, An der Futtergassen: Vom Sportplatz westlich bis Straßengabelung
am Trieb.
74 An der Futtergassen, eine öde Hofrieth: Die Hofrieth des Hoffstatthofes,
Acker an der Straßengabelung am Trieb.
75 Gueßgraben: Pfad an der Westseite des Sportplatzes von der Macksgasse
zum Sportheim.
76 Kürnacher Gotteshauslehen: In der nordwestlichen Ecke des Sportplatzes
gelegen.
77 In der Futtergassen mit Krautfeld: Südlich des Gotteshauslehen (zwischen
Sportheim und Anwesen Schneider).
78 Am alten Mühlweg: ehemaliger Weg vom Seligenstadter Weg zur oberen
Mühle (Mehrzweckhalle).
79 An der Gemeine Viehtrieb: An der Straße zum Hohen Höllberg.
80 Am Dettelbacher Weg: Südöstlich der Mehrzweckhalle. Ehem. Feldweg
von der Marter am Trieb zum Langen Höllberg.
81 Dettelbacher Weeg stoßt an Trieb: In Richtung Langer Höllberg,
rechts vom Dettelbacher Weg.
82 Bey der Martyr: Marter am Seligenstädter Weg.
83 An der Theilbirn: Nördlich der Marter am Seligenstädter Weg,
zieht sich zum alten Mühlweg.
84 Am Heyschleffenhügel: Hügel nördlich der Wegkreuzung unterhalb
langer Höllberg.
85 Beym Dollbirnbaum: Östlich vom Heyschleffenhügel.
86 Am Selgenstadter Weg: Links und rechts vom heutigen Seligenstadter Weg.
87 Am Rieht: Am Bach Richtung Seligenstadter Weg.
88 Am langen Hellberg: Unterhalb der Straße im Hang.
89 Bey dem Großen Bei der Kürnachquelle
Brunnen: Richtung Dorf.
90 Beym Großen Brunnen mit einer Quellen:
Obern Wasserloch: Der Kürnachursprung besteht aus mehreren Quellen.
91 Am Seelein: 2 Äcker, die auf den „Großen Brunnen“
stoßen, Richtung Süden.
92 An der Holzwiesen: Rechts vom Weg „Großen Brunnen“ –
Teerstraße am Wald.
93 Am Schwarzen Brunnen: Auf der Höhe „Käppele“ Äcker
in der Hälfte der Strecke zwischen Prosselsheimer Straße und Betonstraße
zum „Großen Brunnen“.
94 Am Geißbühl: Östlich von „Am Schwarzen Brunnen“
(bis ungefähr zur Teersraße zu den Aussiedlerhöfen.
95 Am Geißbühl bei der Martyr: Östlich vom „Käppele“
an der Straße.
96 Am Geißbühl am Bach: Südlicher Teil vom Geißbühl,
am Bach bzw. Großer Brunnen.
97 An, Neben der Holzwiesen: Holzwiesen östlich von der Kürnachquelle.
98 Ziehet vom Pfaad ins Unterpleichfelder Feld: Etwas östlich vom Käppele,
ehemalige „alte Straß“ nach Oberpleichfeld, Eselsweg.
99 Hinterm Holtz beim (am) Seligenstadter Weg: Hinterm Wald an der Teerstraße.
100 Hinterm Holtz obern Hollerbusch, die Hüthheckel genannt: Ungefähr
bei Aussiedlerhof Ländner, nächste Ackerlänge Richtung Seligenstadt.
101 Bey der Wolfweinberg: Hang zwischen den Aussiedlerhöfen Bayerl und
Baumeister.
102 Am Aubweg: Östlich der Aussiedlerhöfe bis zu den Seligenstadter
Äckern.
103 Am Speierleinsrhein (Hinterm): Südöstlich von „Obern Hollerbusch“
zwischen Aubweg und Seefeld bis zu den Seligenstadter Äckern.
104 Am Seefeld: Zwischen „Speierleinsrhein“ und Wald Richtung
Euerfeld bis zur Gemarkungsgrenze.
105 Bey der Alte Küheruhe: Im Seefeld.
106 Am Hellberg, Am Dettelbacher Weeg: An der „ehem. Georgs. Marter“
am Langen Höllberg.
107 Auf dem Hellberg Von der Marter Richtung Osten und Südosten.
108 Auf dem Hellberg Speierleinsgrund: im Senke östlich von „Auf
dem
Hellberg“.
109 An der Neue Wiesen Bey Rott: Zwischen „Auf dem Hellberg“ und
„Im Speierleinsgrund“ (vermutlich gerodete Waldstück-Senke).
110 Gereutetes Waldstück Erste und zweite Laub: 62 Morgen gerodeter Wald
östlich der Betonstraße zum „Tiergarten“ bis „an
die neue Wiesen bei Rott“
a) Distrikt Rankenholz/Geißbühl
111 Bunker Munitionsbunker Distrikt Geisbühl, gesprengt um 1945/1946.
112 Rangen Hang im Wald, langer Höllberg Richtung Geisbühl.
113 Birkli ehem. Bombenkrater eines Notabwurfs.
114 Siebenweg Rechts und links der Teerstraße durch den Wald Geißbühl
alte Fahrspuren.
b) Distrikt Hart/Seefeld
115 Tiergarten Waldeingang links der Schranke.
116 Kreuzpfad
117 Kohlenplattenweg
118 Schleisenweg
119 Am hohen Tannenweg/Tännig
120 Kaltes Loch
121 Fuchsbau
122 Jägerhaus
123 Silbergrube
124 Hartköpflein
125 Marzätellern
126 Hartmuttergottes
Distrikte:
c) Steebrüch
d) Nußleiten
e) Zimmermannsäcker
f) Erddeponie
1 GeaKü, Flurbücher des Gemeindearchivs Kürnach